TESTPRINZIPBeurteilen der Streichfähigkeit von Vaseline, das bei 4 bzw. 21 °C mit einem aus Kegel und Gegenkegel bestehenden Sondenset getestet wurde.
HINTERGRUNDDie Verteilbarkeit gibt an, wie leicht sich eine Probe in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht über eine Fläche verteilen lässt. Zwischen der Messung der Festigkeit (durch Penetration) und der Messung der Verteilbarkeit besteht ein enger Zusammenhang. Folglich nehmen die Verteilbarkeitswerte einer lipidreichen Probe mit zunehmender Viskosität des Öls ab (zunehmende Härte), was zu einer erhöhten Oberflächenspannung führt, die wiederum ein Gefühl von Fettigkeit und Klebrigkeit beim Auftragen auf die Haut vermittelt.
Vaseline wird als Zusatz zu Hautlotionen und Kosmetika verwendet. Es handelt sich dabei um ein halbfestes Kohlenwasserstoffgemisch. Ein solche Feuchtigkeitspflege wirkt okklusiv, da sie das Wasser in der oberen Hautschicht bindet und verhindert, dass es entweichen kann.
Die Verteilbarkeit von Vaseline ist eine wichtige Eigenschaft, die mit Hilfe eines Werkzeugs zur Prüfung der Streichfähigkeit, bestehend aus einem Plexiglaskegel mit passendem Gegenkegel, Proben- und Basishalter, gemessen wird. Der Test misst die Kraft, die erforderlich ist, um eine bestimmte Verformung zu erzielen, und setzt diese Werte mit sensorischen Schätzwerten der Verteilbarkeit in Beziehung. Beim Eindringen der Kegelsonde in den Gegenkegel wird die Probe gestaucht und in schrägem Winkel aus dem Gegenkegel extrudiert. Dieser Prozess simuliert das Auftragen der Probe auf eine Fläche.
METHODE
| Ausrüstung: |
CT3 mit 4,5 kg Wägezelle |
|
Fixierbank (TA-BT-KIT) |
|
Werkzeug zur Prüfung der Streichfähigkeit (TA-SF) |
|
TexturePro CT Software |
Einstellungen:
| Testart: |
Kompression |
| Geschwindigkeit vor dem Test: |
1,0 mm/s |
| Testgeschwindigkeit: |
3,0 mm/s |
| Geschwindigkeit nach dem Test: |
3,0 mm/s |
| Zieltyp: |
Weg |
| Sollwert: |
13 mm |
| Auslösekraft: |
5 g |
Sonstiges Material: |
Spatel |
|
Papiertuchrolle |
|
Flaches Messer |
PROBENVORBEREITUNG
- Die Probe mit einer Spatel in die vier unteren Kegel (Gegenkegel) einfüllen (der fünfte Kegel bleibt leer, da dieser zum Ausrichten verwendet wird; siehe Testablauf). Es ist darauf zu achten, dass die Probe nicht zu stark aufgeschlagen wird, damit keine Luftbläschen entstehen.
- Die Probe nach unten drücken, um etwaige Lufteinschlüsse zu beseitigen, die durch die Plexiglaskegel sichtbar sind.
- Die Oberfläche mit einem flachen Messer glatt streichen und einige Stunden warten, bis die Temperatur der Probe den gewünschten Wert angenommen hat.
VORGEHENSWEISE
- Den Basistisch auf die Gerätebasis setzen.
- Die Schrauben am Basistisch anziehen, aber darauf achten, dass noch etwas Spielraum zum Ausrichten bleibt.
- Den Basishalter an die Basisplatte montieren und mit den Schrauben an der gewünschten Position festziehen.
- Einen leeren Gegenkegel in den dafür vorgesehenen Probenhalter einsetzen.
- Den Kegel an der Wägezelle befestigen.
- Kegel und Gegenkegel exakt übereinander ausrichten. Dazu den Kegel absenken und den Gegenkegel so positionieren, dass Kegel und Gegenkegel ineinander passen und beinahe bündig aufliegen.
- Jetzt können die Schrauben am Basistisch fest angezogen werden.
- Den Gegenkegel aus dem Probenhalter entfernen und durch eine vorbereitete Probe ersetzen (siehe Abschnitt „Probenvorbereitung“).
- Den Kegel auf wenige Millimeter über der Probe absenken. Der Abstand muss auf alle nachfolgenden Tests angewendet werden, damit der Ausgangspunkt stets gleich ist und die Proben miteinander verglichen werden können.
- Mit der Messung beginnen.
Bitte beachten: Eine präzise Ausrichtung der Sonden ist unerlässlich, um eine Überlastung des Messgerätes zu vermeiden. Die Eindringtiefe darf maximal 90 % der Sondenhöhe betragen.
Schwankungen auf einer steten Kurve sind auf die Verdichtung von Lufteinschlüssen zurückzuführen. Beim Befüllen des Gegenkegels ist deshalb unbedingt darauf zu achten, dass möglichst keine Lufteinschlüsse entstehen.
Der Basishalter sollte zwischen den Tests nicht von der Basisplatte entfernt werden, da Kegel und Gegenkegel ansonsten neu ausgerichtet werden müssen. Der Gegenkegel kann nach dem Test durch Lösen der Schrauben am Basishalter entfernt werden.
Zu Vergleichszwecken muss die Testtemperatur stets in den Messergebnissen festgehalten werden.
ERGEBNISSE
Die nachstehende Grafik einer Texturanalyse mit TexturePro CT ist ein typisches Beispiel für die Streichfähigkeit von Vaseline.

Abbildung I
Abbildung I zeigt die Streichfähigkeit von Vaseline, die bei 4 bzw. 21 °C getestet wurde.
Datensatz 1: Vaseline bei 21 °C
Datensatz 2: Vaseline bei 4 °C
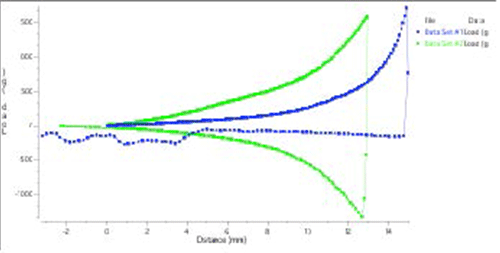
Abbildung II
Abbildung II zeigt den Verlauf der Last-Distanz-Kurve einer bei 4 bzw. 21 °C getesteten Vaseline-Probe.
Datensatz 1: Vaseline bei 21 °C
Datensatz 2: Vaseline bei 4 °C
BEOBACHTUNGEN
Bei Erreichen einer Auslöselast von 5 g an der Probenoberfläche dringt der Kegel bei einer Testgeschwindigkeit von 3 mm/s in die Probe ein. Die Penetrationskraft nimmt dabei bis zu einem Maximum bei einer vorgegebenen Tiefe (in diesem Test 13 mm) zu. Aus der Maximalkraft bei einer Eindringtiefe von 13 mm kann auf die Festigkeit der Probe geschlossen werden. Je höher der Wert, umso fester die Probe. Die Fläche unterhalb der positiven Spitze ist ein Maß für die geleistete Härtearbeit. Etwaige Lufteinschlüsse in der Probe werden in der Grafik als Schwankungen der Penetrationskraft dargestellt.
Wenn sich die Kegelsonde nach dem Test mit einer Geschwindigkeit von 3 mm/s aus der Probe zurückzieht, entsteht ein negativer Spitzenwert. Der negative Spitzenwert ist ein Maß für die Haftkraft; je negativer der Wert, umso „klebriger“ die Probe. Die Fläche unter dem negativen Teil der Grafik ist ein Maß für die Klebefestigkeit (die von der Sonde benötigte Energie, um sich von der Probe zu lösen). Je höher der Wert, umso mehr Energie muss aufgewendet werden, damit sich die Sonde beim Zurückziehen von der Probe lösen kann.
Die Durchschnittswerte für die Härte und geleistete Härtearbeit der vier bei einer Temperatur von 21 bzw. 4 °C gelagerten Vaseline-Proben sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
| Testnummer (°C) |
Härte (g) |
Geleistete Härtearbeit (mJ) |
| 4 |
1854,5 ±70,9 |
67,13 ±12,35 |
| 21 |
1001,3 ±93,7 |
27,04 ±9,53 |
>>Anwendungshinweis im PDF-Format herunterladen